„Wawa Wawawa Wawa Wawawa“
Die Popindustrie lässt sehr gerne tanzen, denn tanzende Menschen strahlen Energie, Vitalität und, wenn gewünscht, auch Befreiung und Rebellion aus. Wegen Covid-19 haben die Tempel und Tresore des Selbstabtanzens geschlossen – die große Party macht große Pause. Jetzt, im Juni 2020, droht in Europa bereits die zweite Pandemiewelle, sodass davon auszugehen ist, dass Clubs und Discos in diesem Jahr nicht wirklich wieder öffnen werden.
Im Vorjahr ahnte noch niemand, was da auf den globalen Spaßpark, aber auch auf das Kulturleben und die Kunst zurollen würde. Der Sommer war heiß, die Festivals feierten trotz der Irritationen rund um das Thema Klimakrise, und alles an Einschränkungen, was nun Wirklichkeit ist, wäre unter der Sonne von 2019 jenseits aller Vorstellung gewesen. Mit den neuen Lebensbedingungen ändert sich auch die Art, wie die Welt, die Politik, die Kunst und die Produktionen der Popindustrie verstanden werden.
Der Popmarkt als Algorithmus
Zum Beispiel das Video zu Fatima Al Qadiris Musiknummer „Spiral“ von 2017. Zwei der darin tanzenden queeren Männer tragen Mund-und-Nasenschutz-Masken. Keine Aufregung, es war nicht Prophetie, sondern ein Statement gegen die starre Geschlechterpolitik in den arabischen Staaten. Das Wiener Festival Impulstanz zeigte im Vorjahr zwei Musikvideo-Programme mit Tanzbezug zu, und „Spiral“ – Regie: Sophia Al-Maria – gehörte dazu. Spannend war das vor allem, weil Musikvideos das allgemeine Bild davon, was Tanz ist oder wie er sein soll, stärker prägen als die Kunstform selbst.

Video: Fatima Al Qadiri „Spiral“
Der Popmarkt funktioniert wie ein hochspezialisierter Algorithmus zur Verarbeitung von Gegenwartsstimmungen. Treffsicher kalkulierend werden Reize, Trends und Moden aufgenommen, in breitenwirksam oder nischenkonform designte ästhetische Muster umgewandelt und in den Markt eingespeist. Daher sind die dazugehörenden Musikvideos eigentlich Werbefilmchen, die heute zum unverzichtbaren Bestandteil jeder Promotion von Bands, Alben und Songs geworden sind. Sie werden ins Internet eingespeist und so zum Teil des ganz großen Digitalgeschäfts. Genau das macht die oft kunstvollen Clips und ihre Tänze so interessant.
„Spiral“ ist nicht wirklich ein Renner auf Youtube. Weniger als 45.000 Aufrufe in zweieinhalb Jahren, das hat beinahe Ladenhüter-Status. 18,5 Millionen in etwas mehr als vier Jahren zeugt von mehr Popularität. Das ist die Quote von „Voodoo in My Blood“ (2016), einer Kooperation von Massive Attack und Young Fathers mit der britischen Filmschauspielerin Rosamund Pike als tanzender Protagonistin.
Im Bann der goldenen Kugel
Dieser Kurzfilm in der Regie von Ringan Ledwidge widerspricht dem Fun-Stereotyp des Pop: Eine Frau stöckelt allein durch den Gang einer Londoner U-Bahn-Station. Dort hat sie eine unheimliche Begegnung mit einer schwebenden goldenen Kugel, die ihr einen Dorn ins Auge sticht, sie mit einem rot leuchtenden Pointer (der an das Kameraauge des bösen Computers HAL in Stanley Kubricks Film „2001: A Space Osyssey“ erinnert) fixiert und wie eine Marionette in dem verlassenen Gang brutal hin- und herschleudert.
Das ist die tänzerische Neudeutung einer ikonischen Filmszene, auf sich die Ledwidge bekennenderweise bezieht: das Überschnappen der von Isabelle Adjani gespielten Hauptfigur bei Andrzej Żuławskis Film „Possession“ (1981) in einem Gang der Berliner U-Bahn-Station Platz der Luftbrücke. Die goldene Kugel – in ihrer Symbolik wie der Reichsapfel ein Zeichen umfassender Herrschaft – als „choreografierendes Objekt“ aus überlegener Technik ist dem Motiv der fliegenden Kugeln aus dem Science-Fiction-Horrorfilm „Phantasm“ (1979) von Don Coscarelli entliehen.

Video: Massive Attack, Young Fathers „Voodoo in My Blood“
Während Adjani ihre Szene innerhalb „natürlicher“ Bewegungsnormen spielt, bewegt sich Pike – unter Anleitung der britischen Choreografin Scarlett Mackmin – in deutlicher Stilisierung. Der Vergleich macht deutlich, wie sehr der Tanz eine Verallgemeinerung herstellt, während Adjanis schauspielerische Bewegungsmuster Subjektivität suggerieren. Es fällt leichter, die von der Schauspielerin dargestellte Figur als Freak zu deuten als die der Tänzerin, deren stilisierte Manipulation durch die goldene Drohne auf eine politische Metapher hinausläuft.
Besser wach bleiben
Auch „Voodoo in My Blood“ war Teil einer der beiden von Christoph Etzelsdorfer (Österreichisches Filmmuseum) und Theresa Pointner (Impulstanz) kuratierten Musikvideo-Selektionen aus der zweiten Hälfte der 2010er Jahre bei Impulstanz 2019. Unter dem Titel B-E-H-A-V-E war im Kino des Wiener Leopold Museums die breite Palette an Körperbildern und Tanzästhetiken in diesen Videos angedeutet. Und im Museum moderner Kunst (mumok) war der Fokus unter dem Titel COLLAPSE auf akustische Strukturen und visuelle Muster gerichtet.
In B-E-H-A-V-E – dieser Titel ist dem Text der Nummer „Kill V. Maim“ von Grimes entnommen – tauchen übrigens auch Marionetten auf: bei Missy Elliotts glitzercoolem „WTF (Where They From)“-Breakdance-Musikvideo von 2015. Die Lyrics deuten in Richtung Wachsamkeit. „The dance you doing is dumb / How they do where you from / Stickin‘ out your tongue girl / But you know you’re too young / (…) Ya’ll still sleep, better stay awakened.“

Video: Missy Elliott „WTF (Where They From)“
Die sechs an ihren Fäden tanzenden Puppen der Furry Puppet Studios aus dem kalifornischen Mountain View (wo unter anderem auch Alphabet/Google oder Whatsapp residieren) stellen Missy Elliott, Pharrell Williams und deren Hintergrundtänzer dar. Die Strippenzieher selbst bleiben im Video anonym, aber Elliott und Williams scheinen so sagen zu wollen, dass auch sie „like you in the matrix“ tanzen.
Eine deutlichere Geste der Auflehnung gegen die Matrix der fitten und angepassten Spaßkultur liefert der estnische Rapper Tommy Cash (geboren 1991 als Tomas Tammemets in Tallinn) mit seinem tänzerischen Video „Pussy Money Weed“, das er 2017 zusammen mit Anna-Lisa Himma produziert hat. Die Pop-Publizistik, in diesem Fall Vice, reagiert mit gespielt prüder Faszination: „Ausdruckstanz auf Laufbändern, Gerüsten und in Rollstühlen – das neue Video des Ausnahmekünstlers aus Estland lässt einen mal wieder in jeder Hinsicht sprachlos zurück.“ Naja, unter „Ausdruckstanz“ wird eben immer noch alles gereiht, was sich nicht in diverse populäre Grobmuster wie Hiphop, Showtanz oder Ballett einordnen lässt.

Video: Tommy Cash „Pussy Money Weed“
Cash pflegt auch hier sein Image als cool-sinistrer Nachkomme eines europäisch-russischen Ostens, der als Underdog die Verrottung stilisiert. Eine verlassene Betonanlage, Tänzerinnen und Tänzer mit Behinderungen: Das zentrale Motiv von „Pussy Money Weed“ ist der verstümmelte und sich in seiner Ausgrenzung durch die Gesellschaft zu neuen Qualitäten aufschwingende Körper: junge Männer in Rollstühlen, ein Balletttänzer mit Föhnfrisur, aber ohne Arme, schöne Mädchen mit geschorenen Köpfen, Tanz auf futuristsch designten Laufbändern, Headspins mit Krücke und eine twerkende Frau mit Beinprothesen aus gefährlich blitzenden Stahlklingen, die mit Tommy Cashs Goldzähnen harmonieren.
Pop oder die Lust an der Plünderung
Der gesamte Clip ist vor allem ein Werbespot für Cashs 2018 gegründetes Modelabel „Kanye East“. Aber wie dieses dient er auch der Aneignung von US-amerikanischen Trend-Ikonen und deren parodierend ironischer Umdeutung in Richtung einer östlichen Identität. Das in „Pussy Money Weed“ geladene Referenzsystem ist vielfältig, aber wer etwa die Anspielungen auf Pop und Kunst in Florentina Holzingers Stücken versteht, hat schon einmal eine tragfähige Brücke zu Kommerz-Subversiven wie Tommy Cash.
Die Popindustrie gründet auf der Plünderung von allem, wäscht die Ideen in Misch- oder Umdeutungsverfahren und sucht die Beute so zu popularisieren und zu vergolden. Eine Strategie der „Neuerfindung“ in Form von Mutationswucherungen. Nicht anders macht es Tommy Cash mit dem Tanz – das ist sehr clever und spiegelt sich in der Kunstform des zeitgenössischen Tanzes: Dort werden seit Jahren, weil nichts Neues mehr erfunden wird, alle möglichen Stile, Techniken und Methoden zusammengemischt.
Narzissmus mit Stil und Glamour
Wie ein Virus hat sich das popkulturelle Mischen in etliche Terrains der Gegenwartskunst eingeschleust, als Gegensatz zu den erfindungswütigen Avantgarden des 20. Jahrhunderts. Wer davon nicht infiziert oder zumindest affiziert wird, hat es gerade vielleicht ein bisschen schwer. Aber gerade in der Stilisierung und Infantilisierung des Pop verbergen sich wahre Schätze für emanzipierte Zuschauer.
FKA twigs zum Beispiel spielt in ihrem Video „Cellophane“ (2019) ein Maximum an Stilisierung aus, lässt virtuosen Pole Dance und ihren spektakulären Fetischkörper in ein üppiges Fantasy-Elysium entschweben. Dort begegnet sie einem köstlichen Drachen, der nach Demaskierung ihr Gesicht trägt, in das sie sich ziehen und fallen lässt. „And I just want to feel you’re there / And I don’t want to have to share our love / I try, but I get overwhelmed / When you’re gone I have no one to tell“, singt sie mit einer lasziven, ätherisch schwebenden Stimme, die ältere Herren und pubertierende Mädchen gleichermaßen an den Rand sehnsuchtsvoller Selbstentleibung führen könnte.

Video: FKA twigs „Cellophane“
„And didn’t I do it for you? / Why don’t I do it for you? / Why won’t you do it for me? / When all I do is for you?“ Die anvisierte Liebesbeute als Selbstbedienungsladen – wie perfekt passt das zur Selbstbedienungsladen-Mentalität einer Tinder-Gesellschaft! Allerfeinster Narzissmus als Gleitmittel-Sprühnebel für einsame Stunden, wahlweise auch zu zweit oder mehreren. Ohne eine psychoanalytische Deutung zu bemühen, stellt der schön choreografierte Fall aus den luftigen Höhen der Pole-Stange in die warmen Untergründe einer weichen Höhle doch eine Symbolik her, die alle verstehen. Denn die Landung im eigenen Schlamm macht auch Ängste sichtbar. „They’re waiting / (…) They’re watching us / They’re hating / (…) And hoping / I’m not enough.“ Die Atemzüge der Figur ganz am Ende des Videos zittern vor Angstlust.
Infantilismus mit Didi und Dada
Und so sind wir gerne Opfer unserer angezüchteten Sehnsuchtsmuster, scheinen FKA twigs große Kinderaugen zu sagen. Von der Stilisierung zur Infantilisierung reichen ein paar kurze Schrittchen, wie der Koreaner Hitchhiker seit 2014 in seinem spaßig bedrohlichen „Eleven“-Clip spüren lässt. Dort entspricht der Tanz der Musik und dem Text. Daher scheint es schier unmöglich, auf ein Zitat zu verzichten:
„[Intro] Wawa / Wawawa / Wawa / Wawawa // [Verse 1] A BABA BABA BABABA BABA / BA BABA BABA BABABABA (…)“ und später: „[Verse 2](…) Kitty / Kitty is run / I like kitty / Ttiririri riri tti didi didi dididi didi dididi di“. Animierte Alienfiguren tanzen durch computergenerierte urbane Gefilde oder auch auf Wiesen, Ständen oder vor animierten Hintergründen, in silbrigen Brandschutzanzügen oder bunten Outfits. Auf einer der zahlreichen Pop-Webseiten heißt es: „There is actually no way to explain how crazy this music video is.“
Was natürlich nicht stimmt, denn Hitchhiker könnte sich beispielsweise auf dadaistische Lautgedichte berufen, auf Hugo Ball („gadji beri bimba glandridi laula lonni cadori / gadjama gramma berida bimbala glandri galassassa laulitalomini […]) oder Kurt Schwitters („kaa gee dee takepak ntapekek / katedraale take tape […]). Also auf die genüssliche Erosion bürgerlicher Wortsinngebilde. Dieser Bezug wäre zwar fiktiv, nimmt aber der leeren Popjournalismus-Hülse „crazy“ den marktschreierischen Reiz.

Video: Hitchhiker „Eleven“
In Wirklichkeit lässt „Eleven“ den großen Gesellschaftsentwurf der neoliberalen Unterhaltungsindustrie über den Bildschirm hüpfen: den hochkantigen Eintritt des Menschen in seine selbstverschuldete Unmündigkeit. Bei Nummern wie dieser ist das „didi didi dididi“ ganz nah, und nicht ohne Absicht sind es elektronisch erzeugte Kinderstimmen, die den Nonsens aus den Lautsprechern in die Gehörgänge der infantilen Spaßgesellschaften auf diesem Globus schicken.
Dada war ein Minderheitenprogramm, hier aber geht es um 6,2 Millionen Zugriffe auf „Eleven“, neun Millionen auf „Cellophane“ oder rund 11,7 Millionen auf „Pussy Money Weed“ – die vielleicht doch nicht ganz auf gekaufte Bot-Zugriffe zurückzuführen sind.
Tanz in digitalen Ruinen
Tommy Cash bildete einen Tunnel zwischen dem ersten Musikvideoprogramm B-E-H-A-V-E, aus dem die bisher genannten Beispiele stammen, und dem zweiten mit dem Titel COLLAPSE. Hier war der Tanzbezug besonders spannend, aus einem einfachen Grund: Er scheint lediglich als Metapher oder in homöopathischer Verdünnung auf. Das schwächt ihn allerdings nicht, sobald er als solcher erkannt wird – etwa in den tanzenden Codes bei „T69 Collapse“ (2018) von Aphex Twin. In wilder Kamerabewegung bauen diese Codes zufallsgenerierte Texte, die ihrerseits zerbröselnde Gebäude herbeizaubern und wieder verschwinden lassen. Daraus wird eine rasende Kamerafahrt durch eine von digitalen Häusersimulationen gesäumte Straße, die mit ihren raffiniert gemischten Farben eine Anspielung auf psychedelische Effekte in der Popkultur der 1970er Jahre sein könnte.

Video: Aphex Twin „T69 Collapse“
Kaum hat man sich damit abgefunden, dass dieser unruhige „Trip“ der Bilder vollkommen menschenfrei sein könnte, also sobald die Kamerafahrt etwas erreicht hat, das sich als digital manipulierte und ins Tanzen gebrachte Landschaft beschreiben lässt, zeigt sich: Da ist der Mensch doch noch. Allerdings als medialer Restmüll in Form zersprengter Bilderschnipsel, die zu Teilen dieser wild zuckenden Landschaft geworden sind, aus der sich auch Schlachthofprodukte erheben, bevor sich alles in einen Mahlstrom verwandelt, der die Bildoberfläche in sich einsaugt.
Formenmassen und Menschenmengen
In einem zweiten Teil dieser Digitalformen-Choreografie wird mit dem Aphex-Twin-Logo gespielt, und es geht um den Tanz abstrakter Formen, der viel mit den animierten abstrakten Choreografien von frühen Filmkünstlern des 20. Jahrhunderts wie Oskar Fischinger gemeinsam haben. Einen noch konkreteren Bezug zu diesen Experimenten mit bewegter Luftbild-Abstraktion zeigt das Musikvideo „The World Welcomes Fame“ (2017) von Slagmålsklubben in der Regie von Alexis Burlat. Dieser Underdog mit lediglich knapp 8700 Youtube-Aufrufen ist eine Choreografie reiner Formen und Farben. Nicht zu verwechseln allerdings mit den Farbeffekten von „Visuals“ von der Art, wie sie gerne bei Konzerten oder Clubpartys eingesetzt werden.
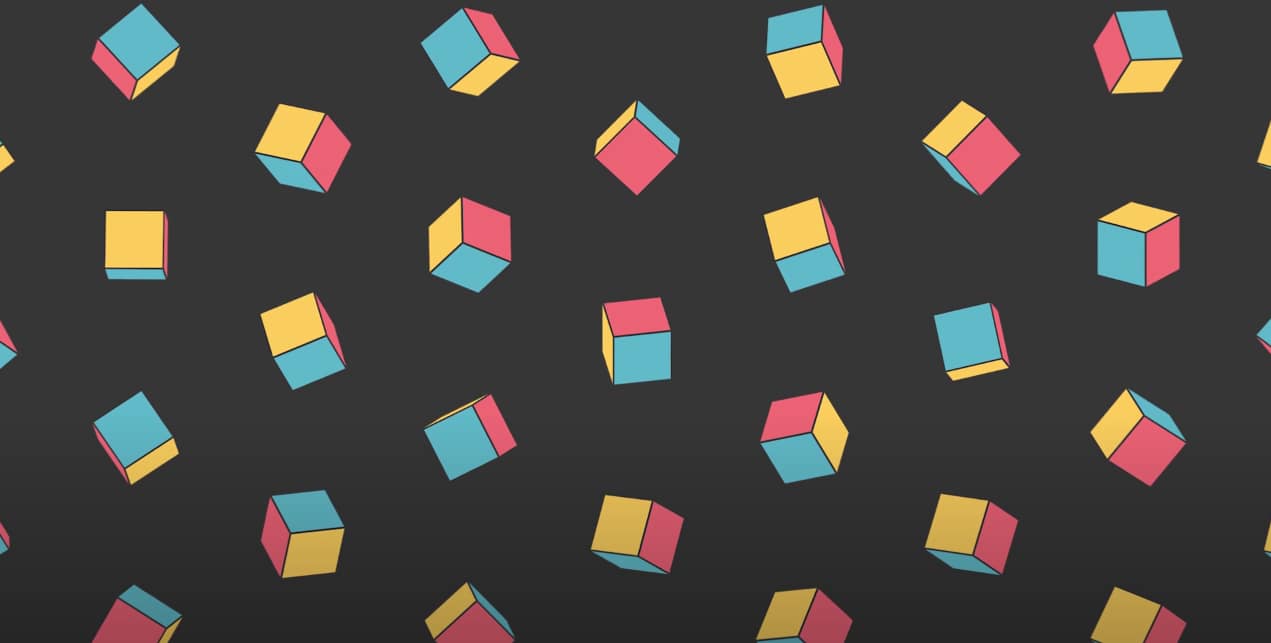
Video: Slagmålsklubben „The World Welcomes Fame“
Der Choreografie von digitalen „Strukturmassen“, also Zerlegungen von Bildmaterial wie bei Aphex Twins „T69 Collapse“ und geometrischen Konstruktionen wie jenen von Slagmålsklubben, entspricht die Bewegungsorganisation einer großen Menschenmenge, die bei „Gosh“ (2016) von Jamie xx zu sehen ist. Regisseur Romain Gavras, Sohn des griechisch-französischen Regisseurs Costa-Gavras, ist für die Aufnahmen in die chinesische Stadt Tianducheng gefahren. Dort zeigt sich die Monstrosität des chinesischen Systems als urbane Fehlplanung. Rohbauruinen ragen auf, und in einem heruntergekommenen Areal steht eine verkleinerte, rostige Imitation des Eiffelturms, die als Attraktion für innerchinesische Tourismuswirtschaft geplant war.

Video: Jamie xx „Gosh“
Gavras arbeitete mit mehr als 400 chinesischen Jugendlichen zusammen, die – alle gleich gekleidet – eine Massenchoreografie unter dem Turm ausführen. Sie positionieren und bewegen sich um einen weiß gekleideten, afrikastämmigen Albino, der zuvor aus einem der Ruinenviertel vor Ort gebracht worden ist, wie um ein Idol. Die Aufnahmen der Massenchoreografie sind übrigens nicht computertechnisch simuliert.
Die Verlassenheit urbaner Betonställe
Von „Gosh“ lässt sich schließlich eine Verbindung zum letzten Videobeispiel ziehen, „Crow“ von Forest Swords. Dieser Künstler hat jüngst die Musik zu Emma Portners Tanzstück „Islands“ beim Norwegischen Nationalballett beigesteuert und arbeitete 2018 für das „Crow“-Video mit Liam Young (Regie) und Alexey Marfin (VFX-Visuelle Effekte) zusammen. Als Grundlage für diesen digitalen Clip dienten Aufnahmen in einem Athener Apartment-Monster. Reine Instrumentalmusik, kein Mensch zu sehen. Die einzigen Bewegungen sind das ruhige Schweben Kamera und das rastlose Suchen der Zuschaueraugen vor dem Bildschirm: Taucht in diesem grauen Plattenbau-Ambiente nicht vielleicht doch irgendwo eine Gestalt auf?

Video: Forest Swords „Crow“
Hier ist, so hat es den Anschein, die Spaßgesellschaft in ihrer Sackgasse angekommen. Trotzdem wurde das Video 7,5 Millionen Mal aufgerufen. Offenbar verfehlen die meditative Musik und die ernüchternde Bildebene nicht ihre Wirkung. Erinnert man sich an die Szene mit den „tanzenden Augen“ in Fritz Langs Film „Metropolis“, wird dieser Effekt vielleicht deutlicher: Die Ekstase des Voyeursblicks angesichts der tanzenden Dämonin ist bei „Crow“ – wo nicht einmal eine Krähe flattert – konterkariert. Vergeblich sucht man nach Lebenszeichen in den Betonställen der Menschenfarm.
Diese zehn Beispiele aus der insgesamt 27 Musikvideos umfassenden Auswahl der beiden Programme B-E-H-A-V-E und COLLAPSE bei Impulstanz 2019 vermitteln bereits den Eindruck, dass das Genre zwischen Clip und Kurzfilm weiterhin seine eigenen Tanz- und Choreografie-Ebenen entwickelt. Diese sind allerdings an die Gesetze der popindustriellen Vermarktung gebunden.
Was, wenn das nicht der Fall wäre, wie etwa bei César Vayssiés Film „Ne travaille pas (1968-2018)“, der 88 Minuten hindurch in atemberaubender Dynamik das Leben eines französischen Tänzerpärchens tanzen lässt? Man muss Glück haben, um diesen Film sehen zu können. Im Internet lässt sich lediglich ein Promotion-Clip finden, der allerdinge einen guten Eindruck davon vermittelt, wie intensiv sich aktives, waches Leben in der Großstadt darstellen lässt.

Video: César Vayssié „Ne travaille pas (1968-2018) “
Vayssié jagt die Blicke des Publikums durch Bilder, die eine Ahnung von der Komplexität und Geschwindigkeit der uns umgebenden Realität vermitteln. Der Wiener Philosoph Armen Avanessian, der über die Überholung des Hochgeschwindigkeits-Kapitalismus durch ein Höchstbeschleunigungs-Denken gearbeitet hat, könnte ein Fan dieses einsamen Meisterwerks filmischer Choreografie sein. Und vielleicht wär’s sogar auch Trisha Brown gewesen, die bereits in den 1960er Jahren ahnte, dass das Laufbild noch zu einer Bürde werden könnte: In „Homemade“ (1966) hat sie mit einem Filmprojektor als „Rucksack“ sich selbst als Tänzerin in den Theaterraum gebeamt.

Video: Trisha Brown „Homemade“
Mehr als ein halbes Jahrhundert später ist aus Browns künstlerischem Witz unterhaltungsindustrieller Ernst geworden: Das Publikum sitzt vor Bildschirmen und lauscht und schaut und lebt in einer ganz neuen, unheimlichen Welt. Darin twerkt der Kollaps vor aller Nasen. Aber „Ya’ll still sleep, better stay awakened“ ist nicht neu: Das hausgemachte Tanzen auf dem Vulkan war auch in den Sixties bereits ganz normal.


